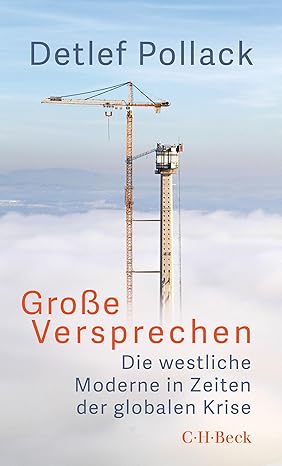Tatsächlich haben wir etwas zu verlieren
Irmtraud Gutschke
Von Detlef Pollack, Religionssoziologe aus Münster, trennt mich meine Sozialisation. Dass ich in der DDR aufgewachsen bin, in Kenntnis der russischen Sprache und des Landes. Auch dass ich mit Bedauern spüre, wie wenig Gewicht Stimmen aus dem Osten gegenüber denen aus dem Westen haben, gibt mir eine andere Prägung als ihm. Doch gerade deshalb hat mir sein Buch viel gegeben, weil er nachvollziehbar seinen Standpunkt deutlich macht, ohne zu polemisieren. Diese seine Methode ist heutzutage so selten geworden und umso wichtiger. Der Autor verweigert sich jeder Polemik, und er hat dieses Buch sogar auch deshalb geschrieben, weil er die derzeitige Polarisierung im öffentlichen Diskurs nicht gutheißt.
Da sehe ich mich an seiner Seite. „Man verneint nicht nur die gegenteilige Meinung, sondern schon die Kompetenz der anderen, Lösungen finden zu können, und manchmal sogar ihre Bereitschaft, sie überhaupt finden zu wollen. Man garniert die Abgrenzung von der Gegenposition mit kopfschüttelndem Unverständnis, zur Schau getragener Geringschätzung und kaum verhohlener Häme.“ Auf jeden Fall führe „die Herabsetzung des anderen zu einer Verschärfung der Kontroverse“. Tatsächlich „wohlfeil sind Aufrufe zur Stärkung der Zivilgesellschaft, zu mehr Einsatz für die gute Sache der Demokratie, zum Aufstehen gegen rechts, zur Besinnung auf unsere Werte.“
Aber wenn er zwei Seiten später schon davon spricht, dass sich der Westen „jahrzehntelang für den Aufbau einer internationalen Friedensordnung eingesetzt“ habe, und Russland „ein diktatorisches Verbrechersystem“ nennt, „das den Kampf gegen den Westen zur Staatsdoktrin erhoben“ habe, möchte ich zumindest daran erinnern, wie die großen Hoffnungen auf ein gemeinsames europäisches Haus, in dem man friedlich zusammenleben kann (durch die Charta von Paris wurden sie ja bestärkt) in Russland zur enttäuschenden Erfahrung wurden, über den Tisch gezogen worden zu sein. Vertrauen ist zerbrochen, aber ich weiß: Sehnsucht blieb.
Detlef Pollack ist nicht der erste, den die Sorge um unser westliches Entwicklungsmodell treibt. Das ist derzeit indes wohl eher von innen bedroht, denn von außen. Ich schreibe „unser“, weil mir die Vorzüge, die er auflistet, plausibel sind. In einem autoritären Staat, wo das Oberhaupt vielleicht nicht einmal abwählbar ist, möchte ich ungern leben. Ich kannte ja eine Gesellschaft, die sich „Diktatur des Proletariats “ nannte, die zunächst mit einer lichten Utopie verbunden war und an ihr scheiterte. Was ermutigende Zukunftsvisionen betrifft, hat die deutsche Regierung momentan leider nichts anderes anzubieten als Aufrüstung. Auch aus der Erfahrung, wie die DDR zu ihrem Ende kam: So wie sich der deutsche Staat derzeit in einen Abwehrmodus hineinsteigert, könnte man den Eindruck gewinnen, dass es sich tatsächlich um ein sozialökonomisches Modell ohne Zukunft handeln würde.
Beschwörend, überzeugend legt der Autor dar, wie sich „die Moderne“ (ich nenn’s Kapitalismus) über die Jahrhunderte entwickelt hat und welche Errungenschaften wir ihr verdanken. In der Tat ist dies ins Bewusstsein zu heben. Aber Detlef Pollack weiß auch um das frustrierende Gefühl, wenn Verheißungen in Enttäuschungen münden. Im Untertitel des Buches spricht er von einer globalen Krise. Aber die ist eben zugleich eine innere Krise des Systems, in dem wir leben. Dass diese krisenhafte Situation überwindbar ist, diese Hoffnung will er vermitteln. Im Namen vieler Ostdeutscher, die schon einmal eine schmerzhafte Transformation hinter sich hatten und nun „transformationsmüde“ sind, wie es der Soziologe Steffen Mau nennt, möchte ich mich dafür bedanken. Das meine ich nicht ironisch. Dass Menschen in gesicherten Verhältnissen so gut wie möglich leben wollen, ist ihnen zuzugestehen. Auch die DDR war ja in einer Krise, wenn auch nicht bankrott. Da verband sich mit der Bundesrepublik für viele Ostdeutsche die Vorstellung einer prosperierenden sozialen Marktwirtschaft mit Aufstiegschancen für jeden. Diese Phase war 1990 allerdings schon in die Vergangenheit gerückt.
„Der Vorschlag, der hier unterbreitet werden soll, lautet also, die westliche Moderne nicht als ein Unternehmen zu verstehen, das seiner Wachstumsorientierung alternativlos ausgeliefert ist, sondern als ein Projekt, das auf Krisen durch Umsteuern und Zurücknahme seiner Steigerungstendenzen reagieren kann, ohne deswegen den ihm eingeschriebenen Fortschrittsoptimismus aufgeben zu müssen.“ Profitmaximierung aufgeben? Oder verstehe ich das falsch? Da kann man tatsächlich nur hoffen, dass wir immer noch in einem flexiblen, lernfähigen System leben, das die Kapazität hat, Krisen auf friedliche Weise zu überwinden. Denn Kriege sind in der Vergangenheit immer wieder ein Ventil gewesen, um in verschiedener Hinsicht Druck loszuwerden.
So sehe ich mich an Detlef Pollacks Seite, wenn er auf die „Lernfähigkeit moderner Gesellschaften“ verweist. Dass es „kein anderes Betriebssystem“ gibt, als „das, was wir haben“, glaube ich so grundsätzlich zwar nicht, aber eines, das wirklich funktioniert, ist noch nicht am Horizont. Dass wir viel zu verlieren hätten, darin bin ich mit dem Autor einig. Überzeugend ist auch sein Gedankenweg, von den Turbulenzen der Gegenwart, die ihn schmerzen so wie mich, „einen Schritt“ zurückzutreten und größere historische Zeiträume in den Blick zu nehmen. Möge die „polyzentrische Struktur“ der Moderne erhalten bleiben, von der Detlef Pollack spricht. So sehr er die „kommunikative Dauerirritation“ mit ihren Empörungsdiskursen beklagt, befürwortet er sie zugleich, weil ein demokratischer Austausch, der den gesellschaftlichen Wandel voranbringt“, so wichtig ist.
Detlef Pollack: Große Versprechen. Die westliche Moderne in Zeiten der globalen Krise. C.H.Beck, 191 S., br., 18 €.