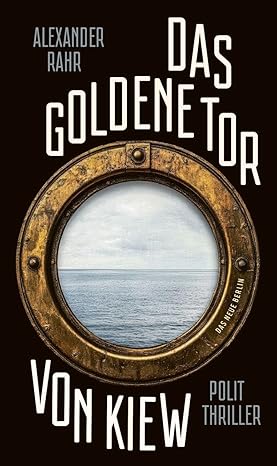Auf dem Drahtseil der großen Geopolitik
„Das Goldene Tor von Kiew“: In seinem neuen Roman verbindet Alexander Rahr Vergangenes mit Zukünftigem, Recherche und Geheimnis
Irmtraud Gutschke
Auf das gedruckte Buch wollte ich nicht warten und bat ich den Verlag um eine PDF. Nach dem Herunterladen meldete sich die KI zu Wort: Es sei doch ein sehr umfangreicher Text, ob ich eine verkürzte Fassung wolle? Wer braucht denn sowas, dachte ich. Da begräbt man doch jegliches literarische Erlebnis!
„Das Dokument ist eine komplexe Erzählung, die historische, geopolitische und futuristische Themen behandelt“, erklärte die KI. Gut, das stimmt. Meinem Vater hätte ich diesen Roman sicher nicht geschenkt. Sachlich rational eingestellt, hätte er keinen Sinn für das phantastisch Spekulative in diesem Buch gehabt. Auf welches ich mich indes gerade freute. Nicht nur mir geht es so: Ein gewisser Zukunftsoptimismus ist einer enormen Unsicherheit gewichen. Mehr noch, einem Bewusstsein von Gefahr. Als ob auf einer kurvenreichen Strecke schon die nächste Biegung in dichtem Nebel liegt und dahinter ein Abgrund lauert.
Wie verheißungsvoll klingt da der Romantitel: „Das Goldene Tor von Kiew“. Gleich hatte ich die majestätischen Klänge aus Modest Mussorgskis „Bilder einer Ausstellung“ im Ohr. Ein wunderbares Leuchten über der gefährlichen Serpentinenstrecke. Als ob es doch eine zuverlässige „Straßenkarte“ gäbe. Verbunden fühle ich mich Alexander Rahr in Hoffnung und Wissen-Wollen. 1959 in Taipeh geboren und in , hat er einen Erfahrungsschatz, von dem ich einiges erahne, aber viel zu wenig weiß.
Sein Großvater Alexander Rahr entstammte einem deutsch-baltischen Kaufmannsgeschlecht, war Erb-Ehrenbürger des russischen Reiches und als solcher dem Adel gleichgestellt. 1924 wurde die Familie nach Estland ausgewiesen. Sein Vater, der Kirchenhistoriker Gleb Rahr, der die Hölle mehrerer faschistischer Konzentrationslager überlebte, war für die Russische Auslandskirche aktiv. Das erklärt den Weihrauchhauch der Orthodoxie im Buch, der mich zusammen mit den liturgischen Gesängen in russischen Kirchen so verzaubert.
Zu Zeiten des Kalten Krieges war Alexander Rahr u.a. als Analytiker bei „Radio Liberty“ und der „Rand Corporation“ tätig. Ein gefragter Russland-Experte: Achtzehn Jahre lang arbeitete er für die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik und saß ab 2004 im Lenkungsausschuss des Petersburger Dialogs, der von Gerhard Schröder und Wladimir Putin ins Leben gerufen worden war, wurde Projektleiter beim „Deutsch-Russischen Forum“, veröffentlichte Biografien über Gorbatschow und Putin. Fortan wurde er vermehrt mehr in Talk-Shows eingeladen, nach 2022 verbannt, aber seine Einblicke in Machtstrukturen konnte ihm niemand nehmen.
Dass er nach mehreren Sachbüchern 2018 einen Politthriller schrieb, hatte auch mit diesem Insiderwissen zu tun, das sich anders nicht enthüllen ließ. „2054. Putin decodiert“ ist aber ebenso wie der neue Roman aus dem Gefühl einer Berufung entstanden, trotz allem für gute Beziehungen zu Russland einzutreten.
In Stalins Datscha nahe Moskau beginnt das Buch. Dort werden einem US-amerikanischen Journalisten – man denkt an Tucker Carlson – vor seinem Interview mit Putin mehrere historische Filme zugespielt, die auch uns mit Hintergrundwissen versorgen, was die historischen Beziehungen zwischen der Ukraine und Russland betrifft. Dass es schon mal einen polnischen Anspruch auf den Zarenthron gab, wissen viele nicht. Immer wieder wird es im Laufe des Romans derlei Nachhilfeunterricht geben, damit wir verstehen, wie die Ukraine zu Russland kam und warum dieses Gebiet andererseits für den Westen so wichtig wurde. Man wünscht sich, das alles in Erinnerung zu behalten und giert zugleich nach spannenden Verwicklungen.
Die gibt es dann mehr als genug. Aus Russland führt die Handlung an die Cȏte d’Azur, wo der Präsident „eines wichtigen EU-Landes“ erwartet wird und der Geheimdienst ein Hintergrund-Treffen plant. „Dinge, die normal sterblichen Ohren verborgen bleiben“, sollen verhandelt werden. Und immer mal wieder sind zwei schöne Frauen mit von der Partie: Nika Stawrogina und Petra, ihrer Partnerin, die sich rühmt, Spezialistin für psychologische Manipulation und Regime-Changes zu sein. Sie stellen sich als Verfechterinnen des Fortschritts dar, halten sich für oberschlau, doch letztlich erfreuen sie sich am Chaos. Zwei Drahtzieherinnen auch im Westen aus dämonischem Willen.
Brüssel, Lissabon, Funchal, Wladiwostok, ein Wohnzimmer in Berlin-Friedenau mit verhüllten Fenstern, ein Café in St. Petersburg … Tanz „auf dem Drahtseil der großen Geopolitik“. Spionagetechnik in der Badehose? Man stelle sich darauf ein, dass eine Menge Intelligenz im Hintergrund ist.
Allein schon die Namen: Einige kommen aus des Autors Umfeld. Der Vater, Gleb Rahr, veröffentlichte unter dem Namen Alexej Vetrov. Hier ist Georgi Vetrov eine der Hauptgestalten. Ein Mann namens Oreschak ist immer wieder an wichtigen Schauplätzen. Wassili Orekhoff tauchte auch im vorigen Roman auf und beide könnten ein reales Vorbild in einem Maler, Schriftsteller und Publizisten haben, Nachkomme einer exilierten russischen Adelsfamilie, bei dem ich sogar schon mal ein Neujahrsfest erlebte.
Nika Stawrogina: Da denkt man an Nikolai Stawrogin, diesen schillernden Charakter aus Dostojewskis Roman „Die Dämonen“. Auch ein Verchovensky kommt dort vor. Hier ist der Professor ein „Prediger des liberalen Kampfes“. Mag sein, dass der Autor mit seinen Reminiszenzen an „Die Dämonen“ bei manchen Lesern etwas zu viel voraussetzt. Wobei das Böse im russischen Vaterunser zugleich das Trickreiche, Trügerische zum Synonym hat. Gibt es das etwa nicht im Menschen, diesen Machtwillen, diesen teuflischen Ehrgeiz, der keine Grenzen kennt und im Widerstreit liegt mit der Sehnsucht nach etwas Gutem, Friedlichem?
Und dann tritt ein General auf, Überläufer oder Abgesandter, der mit Vetrov über den Ukraine-Konflikt debattiert. Die Frage, ob er vermeidbar war und wie er enden könnte, steht doch hinter diesem Buch, das unterschiedliche Meinungen spiegeln muss. US-Präsident Trump als „Elefant im Raum“: Auch wenn der Autor vom Treffen in Alaska nichts wissen konnte, gelingt ihm doch eine hellsichtige Analyse von Chancen und Hindernissen. Der geheime Friedensplan, der Vetrov auf einem Kreuzfahrtschiff zur Kenntnis gelangt, trägt meine Hoffnung. Das letzte Kapitel heißt allerdings „Endspiel Europa“. Und wieder kommt der berühmte Nostradamus ins Spiel wie schon im vorigen Roman, diesmal verbunden mit einem geheimen Bunker in den USA, wo uralte Dokumente mittels KI entschlüsselt werden.
Phantastisch! Da lehne man sich zurück und höre sich noch einmal „Das Große Tor von Kiew“ an, das Mussorgski auch „Heldentor“ nannte, weil Bogdan Chmelnitzkyj mit seinen Saporoger Kosaken hindurchmarschierte, ehe er das Gebiet 1654 (gegen Polen) dem Schutz des Zaren unterstellte. Golden ist nicht das Tor selbst, aber gekrönt von der Kirche „Mariä Verkündigung“, deren Kuppel ihm den Namen gab.
Alexander Rahr: Das Goldene Tor von Kiew. Politthriller. Das Neue Berlin, 432 S., geb., 30 €.