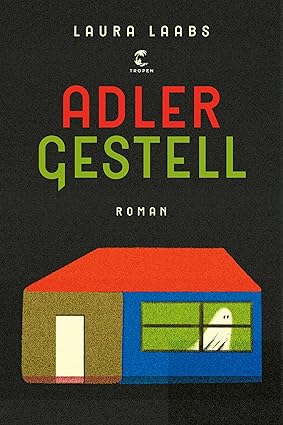„So’ne Wut, wissen Se?“
„Adlergestell“ von Laura Laabs: Umbruchzeiten aus Kindersicht
Da haben sich zwei kleine Mädchen während einer Geburtstagsfeier unterm Tisch versteckt, „während die Alten oben von den Kriegen und den Ländern sprachen“. Heimlich angeln sie sich Katzenzungen und dann Schokobecher, die sie mit Eierlikör füllen. „Eine kichernde Wärme breitete sich von meinem Bauch in meinen Kopf aus. Lenka war da, ihre Augen strahlten wie immer, oder vielleicht ein bisschen mehr, wir hatten unser eigenes kleines Reich außer Reichweite der Erwachsenen, die uns vergessen zu haben schienen …“ Als sich die freche Chaline zu den beiden gesellt, wird’s noch bunter. Sie klauen, prügeln sich, hängen sich abgebrochene Mercedes-Sterne um den Hals …
Was selbst erlebt ist und was erdacht in ihrem Debütroman, könnte Laura Laabs nur selber sagen. Wie ihre Ich-Erzählerin ist sie in einer Reihenhaussiedlung nahe der längsten Straße Berlins geboren, dem „Adlergestell“. 1985 – das ist jetzt 40 Jahre her. Mal taucht sie ganz in die Turbulenzen ihres ersten Schuljahrs ein, dann kommt ihr in den Sinn, was später geschah. Und das, so will es einem beim Lesen scheinen, hängt durchaus mit den Brüchen jener Umbruchzeiten zusammen, welche die Heranwachsenden nicht durchschauten und dabei tatsächlich oft allein gelassen waren. Um ihr Leben abzusichern, brauchten die Erwachsenen ihre ganze Kraft; die Kinder sollten es ihnen nicht noch schwerer machen.
Aber das taten sie. Was ihre Eltern an Ängsten, Frust und Wut hinunterschluckten, lebten sie aus – auf eine so freie, wilde Weise, dass es geheim bleiben musste. Unbewusst. Und der Reiz ist, wie man das beim Lesen immer wieder mit eigenen Erfahrungen konfrontiert. Nur ein Beispiel von vielen: Wenn die drei Mädchen die „Dzierzyński-Kasernen“ jenseits der großen Straße erkunden, ist das für sie nur ein verbotenes Abenteuer. Doch für uns taucht hinter der „Sprelacart-Schrankwand mit den vergilbten Akten“ eine ganze Geschichte auf. Oft braucht die Autorin nur knappe, scheint’s beiläufige Bemerkungen, um ein ganzes Gedankenkarussell in Gang zu setzen.
Gerade weil sie die Tochter der bekannten Publizistin Daniela Dahn und des Schriftstellers Joochen Laabs ist, besteht sie auf künstlerischem Eigensinn. Immerhin hat sie sich vor diesem Buch einen Namen als Hörspiel- und Filmregisseurin gemacht. Gerade wurde ihr Film „Rote Sterne überm Feld“ zum Erfolg. Sie denkt szenisch, auf plötzliche Filmschnitte muss man sich gefasst machen. Kaum hat man sich mit den drei wilden Mädchen angefreundet, kommen andere Gestalten in den Blick. Frau Schiller, die drei Männer und drei gesellschaftliche Systeme überlebte, Chalines Mutter Vanessa, die, minderjährig, von ihrem Trainer verführt worden war, Lenkas Vater Wulf, der arbeitslos wurde und nun mit seinem Zorn nicht klar kommt, die verständnisvolle Tante Nora, die ihr Häuschen in Breslau verloren hatte, inzwischen im bayerischen Trostberg lebt und bald in ein Altenheim verfrachtet wird. Oder Eleftheria, die sich in Deutschland für keine Arbeit „zu schade“ war, was ihr niemand dankte, und nun von ihren Söhnen zurück nach Griechenland gezwungen wird (die elf Seiten hätten einen ganzen Roman tragen können). Vieles, was noch auserzählt werden könnte. Wann war es wohl, dass sich die Ich-Erzählerin in Eleftherias Sohn Panos verliebte, der stolz war, als „schwer erziehbar“ zu gelten? Man versteht, warum sie ihn verließ. Und wie war es mit Jan, der ein Adler-Tatoo auf der Brust trägt? Die Mutter hält ihn für einen Nazi. Ist das so?
Ich überlege, ob 227 Seiten, wohl zu wenig waren, um all das auszudrücken, was die Autorin im Sinn hatte. Aber ist es nicht andererseits gerade spannend zu durchdenken, was bei ihr Andeutung bleibt?
In den Romantext eingeschoben auf schwarzem Papier: Traumsequenzen, Fernsehbilder, Werbespots, Reminiszenzen an ein Computerspiel über Lemminge, das eine „Armageddon-Taste“ hat. Befremden, Verunsicherung. Die Tochter kann die Mutter wohl verstehen: „Sie hat immer im Sozialismus leben wollen. Aber nicht in diesem … Sie hat immer in einer Demokratie leben wollen. Sie hat nie im Kapitalismus leben wollen.“ Aber das ist Vergangenheit. Sie selbst muss sich um ihr Jetzt kümmern, Fuß fassen irgendwie …
Eine große Szene gibt es, als die Bewohner der Siedlung gegen die Rückübertragung ihrer Häuser an einstige Eigentümer aus dem Westen protestierten. Daniela Dahns Buch „Wir bleiben hier oder Wem gehört der Osten?“ handelte davon. Dass bei der Demonstration Steine aufs Adlergestell fliegen würden, war unvermutet. Eine Windschutzscheibe wurde getroffen, eine Frau schwer verletzt. „Fünf Autos Totalschaden.“ Ein Polizist vermutet, dass das Kinder gewesen sein könnten. „Die prügeln, die klauen, die zündeln. Dit is nich mehr wie früher. Da is keen Repekt mehr. Da ist nur noch blanke Doofheit. Und Wut. So’ne Wut, wissen Se?“
Unablässig rauscht der Verkehr übers Adlergestell. „Vielleicht fließt der Strom der Zeit diese Straße entlang.“ In diesem Zeitstrom hat es damals einen Bruch gegeben, der irgendwie nicht heilen will. Und nun fürchten wir wieder, dass etwas zerbricht. Eine Geborgenheit. Immerhin wurde die „Wende“ im Osten von vielen herbeigesehnt, auch wenn Erwartungen enttäuscht worden sind. Die sogenannte „Zeitenwende“ aber bricht einfach über uns herein. Verluste drohen. Unsicherheit, Ohnmacht – Wut wird politisch. Laura Laabs ist ein einprägsamer „Wenderoman“ gelungen, in dem zugleich viel Aktuelles steckt.
Laura Laabs: Adlergestell. Roman. Tropen Verlag, 227 S., geb., 24 €.