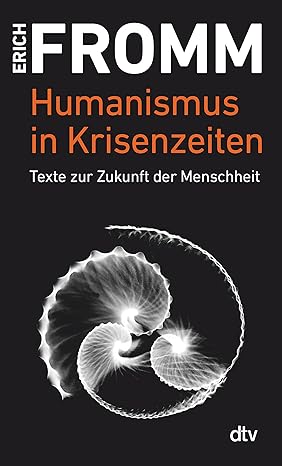„Sind wir geistig noch gesund?“
Irmtraud Gutschke
Ein Buch, wie für den heutigen Tag geschrieben, obgleich der Sozialpsychologe Erich Fromm (1900-1980) schon lange nicht mehr unter den Lebenden ist. Rainer Funk, Psychoanalytiker in Tübingen und sein letzter Assistent, hat mit seiner Zusammenstellung von Texten, das Kunststück vollbracht, gleichsam in unsere Seelen zu sehen. Die Lektüre wirkt so, als ob wir, aufgewühlt und außer Atem. Erich Fromm selber gegenübersäßen, der auf eine ruhige, kluge Weise zu uns spricht. Ja, allein schon, dass der aufgebrachte Ton heutiger Debatten in diesem Buch aufgelöst wird in den Einsichten eines Mannes, der aus dem Abstand seiner wissenschaftlichen Erkenntnisse den Dingen auf den Grund zu gehen vermag, allein das schon macht den Wert dieses Buches aus.
Aus über zehn Publikationen von Erich Fromm hat Rainer Funk eine Auswahl getroffen und unter der Überschrift „Humanismus in Krisenzeiten“ diesen Band zusammengestellt, der sich im kleinen wie im großen der „Zukunft der Menschheit“ widmet. Die Texte greifen in einem umfassenden Sinne Gedanken auf, mit denen man sich konkret selber herumschlägt. „Sind wir geistig noch gesund?“ Wie hängen Angst und Konsumismus, Orientierungslosigkeit und Fanatismus zusammen? Wodurch wird unsere Demokratie bedroht? Wie kommt es zu paranoidem Denken in der Politik? „Die narzisstische Selbstidealisierung als Ersatz für fehlenden Selbstliebe“ – diese oder jenen könnte man nennen, bei denen man solches beobachtet. Politiker auf die Couch? Warum sollten sie? Wenn sie nicht in Höchstform sind, wissen sie, wie sie sich dazu bringen können.
In der Tat erhellend – und beängstigend – sind die Ausführungen, die man lesend auf den geistigen Zustand unserer Gesellschaft bezieht. Eigene Beobachtungen finden sich darin wieder, wo Erich Fromm eben damals schon jene gesellschaftlichen Zusammenhänge in den Blick zu nehmen verstand, auf die wir nach unseren Möglichkeiten reagieren. Sich nicht von fanatischem Denken und Gruppennarzissmus einfangen zu lassen, braucht geistige Arbeit, zu der dieses Buch auf eine großartige Weise beiträgt. Sich selbst erkennen, indem man sich aus einer Distanz zu sehen lernt, ebenso das, was einen an anderen Menschen ärgert. Die Selbstvermarktung – Fromm spricht von einem „Marketing-Charakter“ – ist erzwungen und hat vielerlei Facetten. Das Bedürfnis, „sich identisch und zugehörig zu erleben“, kann auf Abwege führen.
Besonders wertvoll für mich waren die Ausführungen zur Theorie und Strategie des Friedens. Die Seiten 140/141 möchte man sich als Leitfaden für das Auswärtige Amt wünschen, mehr noch für alle, die nur irgendwie in politischer, wirtschaftlicher, militärischer Verantwortung sind. Die „Niederlage des Gegners zu vermeiden“, ist wesentlich, weil sich in diesem Falle die „Politik des Gegners verhärtet – entweder in der Form, dass eine neue Garnitur von Falken zur Macht kommt, oder dass die Menschen, die bisher friedliche Taktiken hatten, ihre Taktik im Sinne der Falken ändern. Die Idee, dass man für den Frieden arbeitet, wenn man dem Gegner diplomatische Niederlagen beibringt, ist falsch“, betont Erich Fromm. „Die einzige Strategie des Friedens ist die Anerkennung der wechselseitigen Interessen – ganz konkret gesprochen – der bestehenden Interessensphären.“ Was einschließen würde, „dass Revolutionen … nicht von den großen Mächten für ihre eigenen außenpolitischen Ziele benutzt werden“. Erich Fromm wusste also schon genau um diese Praxis, geopolitische Vorteile zu erlangen.
Das Problem ist nur, dass in der heutigen Welt nicht die Friedens-, sondern die Kriegsstrategie gedanklich bereits vorherrscht, während wir (zumindest in Deutschland) uns eines Lebens im Frieden erfreuen dürfen. Dass dies nur durch eine Konfrontationspolitik abzusichern sei, wird uns mit zunehmender Stärke eingeredet. Wie Macht und Angst zusammenhängen, hat Erich Fromm natürlich gewusst.
In seiner Überzeugung eines umfassenden Humanismus steht er nicht allein. Aber: „Ist der moderne Mensch im zwanzigsten Jahrhundert tatsächlich darauf vorbereitet, in Einer Welt zu leben? Oder ist es so, dass wir zwar intellektuell im zwanzigsten Jahrhundert, gefühlsmäßig aber in der Steinzeit leben?“ Im 21. Jahrhundert spitzt sich diese Frage sogar noch zu. In „Krisenzeiten“ ist die Zuflucht in nationalistische Ressentiments verführerisch. Wobei das ja nicht nur eine Gefühlsangelegenheit ist. Es geht letztlich um handfeste ökonomische und politische Interessen im Kampf um die Vorherrschaft, die Reichtümer der Welt auszubeuten. Da mögen unsere jeweiligen Sympathien auf dieser oder jener Seite sein, aber in diesem Clinch kann sich derzeit offenbar keine Seite leisten, das rabiat Militärische von sich zu weisen. So sehr ich es mir wünschen würde, weil ich nicht zuletzt durch die Lektüre Aitmatows ein „planetarisches Bewusstsein“ in mir trage.
Erich Fromm: Humanismus in Krisenzeiten. Texte zur Zukunft der Menschheit. Herausgegeben und eingeleitet von Rainer Funk. dtv, 251 S., br., 14 €.