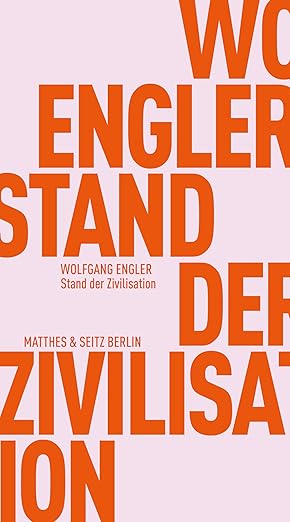Was wir nicht verlieren dürfen
„Stand der Zivilisation“: Wolfgang Engler gelang ein großer Wurf
Irmtraud Gutschke
Fast hätte man in seinem Erinnerungsband „Brüche“ eine Art Fazit sehen können. Doch nun dieses kleine Buch aus der verdienstvollen Reihe „Fröhliche Wissenschaft“ bei Matthes & Seitz: Auf kaum mehr als 150 Seiten ist Wolfgang Engler eine Bestandsaufname unserer Gegenwart gelungen. All dessen, was uns ängstigt und ohnmächtig fühlen lässt, womit wir aber bewusster umgehen können, wenn wir es in seinen Zusammenhängen durchschauen: Wie der ökonomische Standortwettbewerb unser Leben prägt, wie Innen- und Außenpolitik ineinander greifen, Corona, Fremdenhass, Trump, der Abstieg der „Grünen“, rechte Ressentiments, Ost und West, Angst vor Krieg …
Wolfgang Engler, 1952 in Dresden geboren, ist Kultursoziologe und war lange Rektor der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin. Dies ist, wenn ich richtig gezählt habe, sein 18. Buch seit 1989, als er zwischenzeitlich auch einen Lehrauftrag in Klagenfurt hatte. Sein Markenzeichen: Er ist bei seinen Untersuchungen kein Unbeteiligter. Er nimmt seine Denkanstöße aus der Realität, die ihn umgibt. Etwas geht ihm unter die Haut und will ergründet sein.
Wie der Wutausbruch eines Patienten im überfüllten Wartezimmer einer Arztpraxis. Kein Einzelfall, erklärt ihm die Ärztin. Wie gerade im medizinischen Bereich extrem forderndes Verhalten und offene Aggressionen zugenommen haben, bringt Engler zum Nachdenken. „Da ist einer krank, und sechs Leute kommen als Begleitung mit in die Praxis oder die Notaufnahme und machen Radau …“
Man ahnt, es könnte eine migrantische Familie sein. Sie sind besorgt, wollen sich Geltung verschaffen, die man ihnen allzu oft versagt. Durch gefährliche Situationen sind sie gegangen, immer dieses gelobte Land Germany vor Augen. Doch hier angekommen, fanden sie nicht, was sie ersehnten, wurden, in ständiger Angst vor Zurückweisung, erst einmal in Auffanglagern untergebracht, ohne Recht, Geld zu verdienen, das sie nach Hause schicken wollten.
Abgleiten in kriminelle Strukturen, sexuelle Übergriffe und rechtsextreme Anfeindungen – was hierzulande die Gemüter bewegt, dem geht Wolfgang Engler analytisch auf den Grund. Erinnert daran, „dass sich der zivilisatorische Fortschritt des Westens über Jahrhunderte hinweg und bis in die Gegenwart zu Lasten der Entwicklung anderer Weltregionen, ganzer Kontinente vollzog, dass der globale Westen Menschen- und Bürgerrechte proklamierte, während er den globalen Süden in Armut, Abhängigkeit, Rückständigkeit hielt …“
Bei all dem „geht von den zivilisatorischen Errungenschaften des Westens eine Strahlkraft aus“. Prägnant führt der Autor vor Augen, woran wir uns gewöhnt haben: „mehr Gegenseitigkeit, ausgewogenere Machtverhältnisse. Polizisten, Lehrer, Ärzte, Behördenvertreter, Gefängniswärter, leitende Angestellte … sehen sich in ihrem Verhältnis zu Bürgern, Schülern, Patienten, Klienten, Inhaftierten, Unterstellten, Frauen und Kindern veranlasst, die Autonomie, das Recht auf Selbstbestimmung und die Unversehrtheit der anderen stärker anzuerkennen, als das noch vor Jahrzehnten üblich war.“ Das dürfen wir nicht verlieren.
Die „rückwärtsgewandte Fortschrittserzählung“ der AfD kann nicht aufgehen. Weshalb aber findet sie Anklang? „In vom Neoliberalismus umgepflügten Gesellschaften gärt massenweise Wut.“ Diese Aussage von Wolfgang Engler (aus seinem mit Jana Hensel veröffentlichten Buch „Wer wir sind“) habe ich schon oft zitiert. Hier fasst er das Problem historisch und soziologisch: „In Aufstiegsgesellschaften ist die Notwendigkeit, seine Affekte zu zügeln, die Folgen seines Handelns für andere zu bedenken, für die Mitglieder fast aller sozialen Gruppen einleuchtend … Die innere Disziplinierung ‚rechnet‘ sich, es geht voran im Leben, wenn auch nicht für alle in gleichem Maße, aber das ist verschmerzbar, solange sämtliche Boote vom ‚Fortschritt‘ emporgetragen werden.“
Neoliberal reorganisierte Gesellschaften hingegen fegen soziale Versprechen immer rigoroser vom Tisch. „Selbstkontrolle, Disziplin sind weiter gefordert“, aber wer nicht vorankommen kann, kommt „über kurz oder lang zu der Einsicht, dass das zivilisatorische Kalkül für einen persönlich nicht mehr aufgeht, dass man ‚einzahlt‘, aber nicht genug herausbekommt“. Wenn nicht aggressiv außen getragen, führt dies, häufiger noch, zur inneren Kündigung. Man macht sich nicht mehr krumm, ist sich selbst der nächste.
Wolfgang Engler hat Recht, wenn er die zivilisatorischen Bedeutung von Bildung hervorhebt. In Christian Barons Buch „Ein Mann seiner Klasse“ sieht er ein Beispiel und im „Rückbau von Hoffnungen“ eine Gefahr. „Verlust an Systemvertrauen“, Frust, wenn sich Menschen in ihren Qualitäten und Fähigkeiten abgewertet fühlen. Wozu noch „Pflichtgefühl, Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit, Kollegialität“? Wer so fühlt, liest „in vorauseilender Erwartung … aus an sich belanglosen Vorkommnissen eine gezielte Verletzung der eigenen Würde heraus und fährt beim nächsten Tiefschlag unversehens aus der Haut“.
Konfliktpotenzial, mit dem man so oder so umgehen kann. Nach einer Wendung zu mehr sozialer Gerechtigkeit sieht es momentan leider nicht aus. Eher droht die Zuflucht zu einem Maßnahmestaat. Wenn Zivilisierung die „Verwandlung sozialer Fremdzwänge in Selbstzwänge“ meint, muss es erschrecken, wie in der Öffentlichkeit mögliche Fremdzwänge auf Akzeptanz getestet werden. Abschiebung von Migranten: Man ist nicht selbst betroffen. Kürzung von Sozialleistungen: Wer arbeitet und wenig verdient, stimmt zu. „Rangordnung der Randständigen“: Immer scheint jemand da sein zu müssen, auf den man herabschauen kann. Dieses Buch lesend, begreift man, in welche Krise eine Gesellschaft gerät, die nicht mehr aufs Gemeinwohl setzt, und wie bedrohlich das Bestreben ist, damit machtpolitisch fertig zu werden.
Wolfgang Engler: Stand der Zivilisation. Matthes & Seitz, 157 S., br., 15 €.